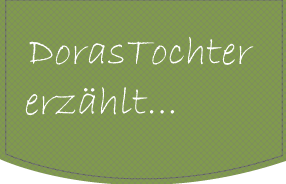Das Element Feuer in Märchen, Mythen und Brauchtum
von dorastochter

Was wäre die Welt nur ohne Feuer?
Und was wäre wohl aus uns Menschen geworden, hätten wir nicht gelernt, es für uns nutzbar zu machen? Die griechische Mythe spricht es deutlich aus, wenn sie davon berichtet, wie Prometheus den Menschen nicht allein das Feuer brachte, sondern auch das Wissen, welches Athene ihm dereinst vermittelt hatte. Mit der Nutzbarmachung des Feuers geht die Kultur des Menschen direkt einher – nicht nur symbolisch gedacht, indem das Wissen Licht ins Dunkel bringt, sondern auch ganz konkret als Voraussetzung für die Entstehung von Kultur überhaupt.
Prometeus entzündet die Fackel am Sonnenwagen
Ohne die Fähigkeit durch kontrolliertes Feuer Licht und Wärme zu erzeugen, Krankheit und Fäulnis einzudämmen, Speisen geniessbar zu machen, Töpferwaren zu brennen und Metalle zu verarbeiten, ist die Kultur des Menschen schlicht und ergreifend nicht denkbar.1 Jetzt hat Prometheus die Fackel, welche er den Menschen übergab aber gerade am Sonnenwagen entzündet.2 Das heisst, das Feuer kommt vom Himmel und stammt direkt von der Sonne selbst – ein Motiv, das wir nicht nur in der griechischen Mythologie antreffen. Die Symbolik von Sonne und Feuer ist denn auch stark aufeinander bezogen.
Das Sonnenrad
Der Bogen, den die Sonne im Verlauf eines Tages beschreibt, ihr Aufgehen, höher Steigen, wieder Sinken und Untergehen, wiederholt sich im Jahreskreis. Weltweit leben wir mit diesen Rhythmen von Hell und Dunkel, von Tag und Nacht. In unseren Breitengraden haben wir zudem ausgeprägte Jahreszeiten, denn die Vegetation steht in unmittelbarer Reaktion zum Sonnenstand und hierzulande steigt die Sonne zum Sommer hin immer höher und sinkt zum Winter hin wieder tiefer. Was die Jahreskreisfeste eigentlich abbilden, ist dieses Sonnen- bzw. Jahresrad mit den Achsen der acht Jahreskreisfeste.
Vom Kommen, Werden, Vergehen und Wiederkehren der Sonne
Mit der wieder erstarkenden Sonne ist das Feuer das dem Sommer zugeordnete Element und wird deshalb besonders mit Walpurgis im Südosten und der Sommer-Sonnwende im Süden des Jahresrads verbunden.3 Dies ist auch die Zeit im Jahr, in welcher die Liebeskräfte am stärksten sind. Sexuelle Vereinigung ist die zwingende Voraussetzung für neues Leben. Wenn es um die Sonne geht heisst das, sie zeugt mit der Erde die neue Vegetation und sich selbst als ihr eigener Nachkomme. Im mythologischen Bild haben wir den Sohngeliebten, der mit der Frau schläft, die ihn später wieder gebären wird. Dieses Bild hat nichts mit Inzest zu tun, sondern ist komplexe Symbolik. Wenn die männlich gedachte Sonne im Sommer nicht die Liebe feiert, kann sie zu Mittwinter nicht wieder geboren werden. Und wenn sie sich am Mittag nicht mit der Frau paart, die sie wiedergebären wird, kann sie am anderen Morgen nicht wieder kehren.
Das Feuer am Himmel und das Feuer auf der Erde
Mythologisch betrachtet ist die Sonne also sterblich und wird gleich gesetzt mit dem ewigen Kommen, Werden, Vergehen und Wiederkehren des Lebens. Deshalb muss zu gewissen Zeiten auch das Feuer rituell erneuert werden, denn im Brauchtum folgt das Feuer weitgehend dem Lauf der Sonne und steht wie sie stellvertretend für die sich zyklisch erneuernde Kraft des Lebens. Mit Fastnachts-, Oster- und Walpurgisfeuern wird sie angefeuert, höher und höher in den Himmel zu steigen, mit Mittsommer- und Freudenfeuern in ihrem Zenit geehrt, im Herbst folgen die kleinen Lichter des Ahnengedenkens, die ihr Sterben begleiten und zu ihrer (Wieder-)Geburt zu Mittwinter hin, wird sie mit den sich mehrenden Kerzenlichtern auf dem Adventskranz sehnlich herbei gerufen.
Von Nut und Re
Ein ebenso klassisches wie schönes Bild des Sonnenlaufs zeigt die ägyptische Mythe der Himmelsgöttin Nut, welche Re, den Sonnengott jeden Morgen von Neuem gebiert, mittags mit ihm die Liebe feiert und ihn jeden Abend wieder verschlingt. Eine Variante dieses Motivs finden wir im böhmischen Märchen „die Reise zur Sonne“. Hier trifft ein Küchenjunge – der sicher eine Menge von Feuer versteht, da er in der Küche arbeitet – nach langer Suche auf die Sonne:
Auszug aus dem Märchen "die Reise zur Sonne"
„Schon war er nicht weit mehr vom Ende der Welt: da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er eilte aus Leibeskräften, soviel er konnte. Als er hinkam, ruhte die Sonne eben im Schosse ihrer Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankten ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er sagte: ‚Wie kommt es, dass die Sonne vormittags immer höher und höher steigt und immer mehr wärmt, nachmittags aber wieder niedersinkend immer schwächer und schwächer wird?’ Die Sonne sprach zu ihm: ‚Ei mein Lieber, sag' doch deinem Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst an Leib und Kraft, und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit mir ist's so. Meine Mutter gebiert mich jeden Morgen neu als einen schönen Knaben, und jeden Abend begräbt sie mich als einen schwachen Greis.’ (...).“ 4
Von Wiederauferstehung und ewigem Leben
Da die Sonne aber stets wieder zurück kehrt aus dem Reich der Toten, finden wir in den Märchen rund um die Sonne eine auffallende Häufung eben dieses Motivs der Wiederauferstehung. In einem Tessiner Märchen kennt einzig und allein der Vogel Phönix den Weg zum Sonnenschloss – was uns nicht wundern sollte, ist er doch selbst ein Ausdruck der sich immerzu erneuernden Sonne. Und als wäre es das selbstverständlichste der Welt, berührt der junge Held am Ende der Geschichte die verstorbenen Angehörigen seiner Braut, worauf diese zu neuem Leben erwachen.5 Ähnliches wird uns in einem siebenbürgischen Märchen erzählt. Nicht nur machen die Äpfel des Sonnenkönigs aus alten wieder junge Menschen. Kaum ist der unter vielen Abenteuern und Mühen errungene Zweig des Sonnenbaums auf dem Grab der Königin in die Erde gesteckt, steigt sie so frisch und munter daraus hervor wie zu Lebzeiten.6
Der Jul-Eber
Dass es ausgerechnet einem Einäugigen bestimmt ist, den Zweig des Sonnenbaums herbeizuschaffen, hat damit zu tun, dass die Sonne in der Mythologie zuweilen auch als Auge dargestellt wird. Und davon gibt es dann eben nur eins. Ein schönes Beispiel dafür finden wir beim germanischen Froh: „Am schneegrauen Winterhimmel tat sich ein graues Fenster auf wie ein Augenlid, dahinter ein strahlendes Auge blitzte (...) Es war aber das sonnige Auge des göttlichen Froh (...).“7 Selbiger Froh, auch Frey genannt, reitet häufig auf einem goldborstigen Eber daher, in welchem wir in diesem Kontext ebenfalls ein Sonnensymbol erkennen. Falls Sie zu Weihnachten oder Neujahr Glücksschweinchen verschenken, dann steht das letztlich in der Tradition alter nordischer Bräuche rund um die göttlichen Erscheinungen von Freya und Frey als Schwein und Eber. Und letzterer genoss als Jul-Eber gerade zu Weihnachten, der Winter-Sonnwende, besondere Verehrung.
Feuer als Verbindung zwischen den Welten
So wie die Sonne sich am Himmel wandelt, so wandelt das formlose Feuer in sich und verwandelt, was mit ihm in Berührung kommt. Wo es unserer Kontrolle entgleitet, wird es schnell brenzlig und mit dem Feuer spielen kommt selten gut. Eine Herdstelle wird besser rein gehalten. Nicht von ungefähr finden sich im Brauchtum allerlei Empfehlungen und Regeln dazu. Ein Herdfeuer, das achtlos beschmutzt oder beleidigt wird, kann sich durch verheerende Brände rächen. Mancherorts wurde es täglich gefüttert, wobei schwer zu sagen ist, ob die Speisen dem Herdgeist oder den Ahnen galt. Denn das Feuer zeigt sich immer wieder auch als ein Bindeglied zu den Ahnen, als eine Verbindung zwischen den Welten, und so finden wir in den Feuerstellen eben auch den Ort der Ahnenverehrung (Link).
Die Kraft der Liebe
Aus Holz macht es Asche, aus Toten Rauch. Wo Wälder niederbrennen ist die Erde später besonders fruchtbar und aus dem Herd der Zerstörung geht neues Leben hervor. Feuer symbolisiert den Tod und ist zugleich Grundlage für neues Leben. Als ein Element der Wandlung zeigt es auf, dass es eben gerade nicht das nicht-sterben ist, das zur Unsterblichkeit führt, sondern die Hingabe an die Liebe, welche die Kräfte des Lebens und die Kräfte des Todes gleichermassen mit einschliesst.
Literatur
1 Barbara Stamer (Hrsg.); Märchen vom Feuer. Fischer, 1996, S.179
2 Robert von Ranke-Graves; Griechische Mythologie. Rowohlt, 1989,
S. 127 f.
3 Ursula Seghezzi, Macht – Geschichte – Sinn. Van Eck Verlag 2011,
S. 15 ff.
4 Wenzig, Josef; Westslawischer Märchenschatz. Leipzig Lorck, 1857
5 „Das Sonnenschloss“; in Sigrid Früh, Märchen von den Sternen. Königsfurt-Urania 2012
6 „Vom Sonnenbaum“; in Helmut Wittmann, Wo der Glücksvogel singt. Ibera 2000
7 Vera Zingsem, Vom Charme der germanischen Göttermythen, Klöpfer&Meyer 2010, S. 97 ff.